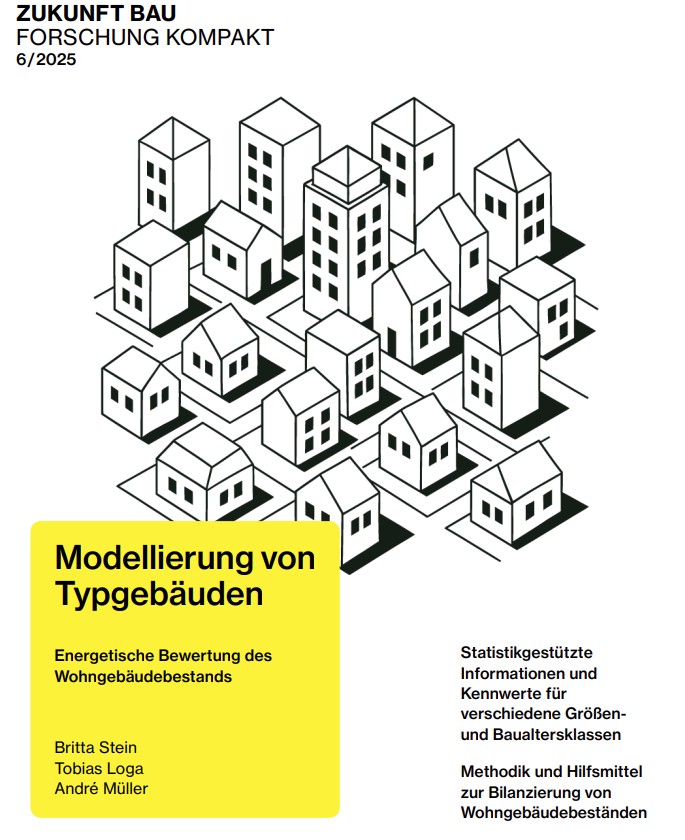Die energetische Transformation des Gebäudebestands stellt Planende, Kommunen und Wohnungsunternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Eine fundierte Datengrundlage ist essenziell, um Energiebedarfe nicht nur auf Einzelgebäudeebene, sondern auch für größere Bestände – etwa Quartiere oder Portfolios – realistisch abzubilden. Das vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU) entwickelte Typgebäudemodell, vorgestellt im Rahmen des BBSR-Forschungsformats Zukunft Bau – Forschung Kompakt 6/2025, bietet hierfür ein praxisnahes Instrument.
Im Zentrum des Projekts steht die Entwicklung synthetischer Typgebäude, die als funktionale Repräsentanten für reale Wohngebäude unterschiedlicher Baualters- und Größenklassen dienen. Die Modellierung basiert auf empirischen Daten zu Wohnfläche, Hüllflächen, thermischen Eigenschaften und Wärmeversorgungssystemen. Für die Referenzjahre 2009, 2016, 2020 und 2025 wurden Energiebedarfe nach Energieträgern berechnet und mit realen Verbrauchsdaten abgeglichen. Die Ergebnisse ermöglichen eine differenzierte energetische Bilanzierung des deutschen Wohngebäudebestands.
Das Modell unterscheidet im Basismodell sechs Typgebäude (drei Baualtersklassen × zwei Größenklassen: Ein-/Zweifamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser). Für 2025 wurde ein erweitertes Modell mit 54 Typen entwickelt, das zusätzliche Differenzierungen wie Gebäudetypologie (z. B. Reihenhaus, freistehend) und Wohnungsanzahl berücksichtigt. Die Bilanzierung erfolgt mit der TABULA-Methodik und liefert Kennwerte zu Nutz-, End- und Primärenergiebedarf sowie Treibhausgasemissionen – sowohl spezifisch als auch aggregiert.
Ein besonderer Mehrwert liegt in der Übertragbarkeit: Die Typgebäude können als Ausgangspunkt für Szenarien, Monitoring oder kommunale Wärmeplanung dienen. Excel-basierte Werkzeuge zur Hüllflächenschätzung und Energiebilanzierung unterstützen die Anwendung. Ein Anwendungsbeispiel in einem fernwärmeversorgten Quartier zeigt, dass individuell angepasste Typgebäude realitätsnähere Ergebnisse liefern als das Basismodell.
Gleichzeitig weist das Projekt auf bestehende Unsicherheiten hin – etwa durch veraltete oder unvollständige Datenquellen – und formuliert Empfehlungen zur Verbesserung der Datengrundlage. Die Etablierung einer nationalen Gebäudedatenbank im Sinne der EU-Gebäuderichtlinie 2024/1275 könnte hier Abhilfe schaffen.
Insgesamt stellt das Typgebäudemodell ein robustes Werkzeug für die energetische Bewertung und strategische Planung im Gebäudesektor dar. Es bietet eine strukturierte, nachvollziehbare Grundlage für die Entwicklung und Bewertung von Sanierungsstrategien – sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene.
Modellierung von Typgebäuden
Energetische Bewertung des Wohngebäudebestands
Britta Stein, Tobias Loga, André Müller
BBSR (2025)